Ob Schul- oder Komplementärmedizin oder beides kombiniert: Die Menschen wünschen sich eine Behandlung, die wirkt. Und die Wissenschaft will die Wirksamkeit messen können – das ist nicht immer einfach, und es kostet Geld. Warum wir in Evidenz investieren sollten und wie Politiker den Begriff für ihre Zwecke missbrauchen.
von Lukas Fuhrer
Für eine Behandlung muss Evidenz vorliegen
Um ihren Patientinnen oder Patienten helfen zu können, stützen sich Ärztinnen und Therapeuten auf erforschte und bewährte Behandlungsmethoden. Der Fachbegriff dafür heisst Evidenz: Damit eine medizinische Behandlung durchgeführt wird, muss Evidenz vorliegen, also der Nachweis, dass die Methode dem Patienten hilft. Bei herkömmlichen Medikamenten liefern diesen Nachweis oft klinische Studien, sie sind aber nicht das alleinige Kriterium.
Ärzte sollen bei ihren Behandlungsentscheidungen auf die besten wissenschaftlichen Studien zurückgreifen – genauso wichtig ist aber, dass sie ihr eigenes Wissen und ihre Erfahrung einbeziehen, um Studienergebnisse richtig zu interpretieren und auf den individuellen Patienten anzuwenden. Und schliesslich sollen die Wünsche und Bedürfnisse der Patienten in die Behandlung einfliessen, die Patienten sollen sich aktiv am Genesungsprozess beteiligen können, sich gemeinsam mit dem Arzt mit ihrer Situation und den Behandlungsmöglichkeiten auseinandersetzen.
Evidenz besteht nicht nur aus klinischen Studien

Dr. med. Pierre- Yves Rodondi ist ordentlicher Professor an der Universität Freiburg und leitet dort das Institut für Hausarztmedizin.
Auf den drei Säulen klinische Studien, Erfahrungswissen der Ärzte und Wünsche der Patienten steht das Modell der evidenzbasierten Medizin, das der kanadische Mediziner David Sackett in den 1990er-Jahren begründet hat.
Für die Weiterentwicklung der integrativen Medizin in der Schweiz spielt die evidenzbasierte Medizin eine Schlüsselrolle, erklärt Dr. med. Pierre-Yves Rodondi, ordentlicher Professor an der Universität Freiburg und Direktor des dort ansässigen Instituts für Hausarztmedizin: «Wir wollen für komplementärmedizinische Methoden dieselben Standards anwenden wie für klassische Behandlungen.
Wir wollen für komplementärmedizinische Methoden dieselben Standards anwenden wie für klassische Behandlungen.» Dr. med. Pierre-Yves Rodondi
Da klinische Studien bei vielen Methoden aber gar nicht möglich sind, beispielsweise weil wir keine Doppelblindstudien machen können, müssen wir das Erfahrungswissen der Behandelnden und die Erfahrungswerte der Patienten sammeln und erforschen.»
Angriff auf die Grundversicherung
Der Nationalrat will die Komplementärmedizin aus der Grundversicherung ausschliessen und ein Wahlobligatorium schaffen – nicht mehr alle Versicherten könnten sich so ärztliche Komplementärmedizin leisten. Der Dachverband Komplementärmedizin Dakomed (Herausgeber von Millefolia.ch) ergreift alle Massnahmen, um dies im Zweitrat zu bekämpfen.
Die Erfahrungen der Ärztinnen und Patienten zählen
Ein anschauliches Beispiel für gesammeltes Ärzte- und Patientenwissen ist die Akupunktur. Das Stechen von Nadeln in Energiebahnen, die den Körper durchziehen, die sogenannten Meridiane, praktizieren Medizinerinnen und Mediziner schon seit 3000 Jahren. Die Behandlungserfolge bei Beschwerden von chronischen Schmerzen1 bis Migräne2 sind gut dokumentiert, die Summe der positiven Erfahrungsberichte verleiht der Methode Evidenz.
Obwohl oder vielleicht gerade, weil für die Wirksamkeit der Akupunktur so gute Erfahrungswerte vorliegen, wurde viel in die Weitererforschung der Methode investiert, insbesondere in den USA, sagt Pierre-Yves Rodondi: «Das hat beispielsweise dazu geführt, dass wir heute für die Akupunktur randomisierte Studien haben, bei denen gegen Placebo gemessen wird, indem die Nadeln absichtlich, aber ohne das Wissen des Patienten an einer falschen Stelle gestochen werden.» Oder es gibt Studien, die mit Magnetresonanztomografie (MRT) nachweisen, dass bei der Akupunktur bestimmte Gehirnbereiche aktiviert werden, was sich positiv auf die zu behandelnden Beschwerden auswirkt.

Die Akupunktur ist schon gründlich erforscht, auch im Hinblick auf die Patientenerfahrungen
Es braucht mehr Forschungsgelder
Für den Professor für Hausarztmedizin illustriert die Akupunktur zweierlei. Erstens, dass in der evidenzbasierten Medizin nicht immer der Wirkmechanismus bekannt sein muss: Der Akupunktur ist es bis heute nicht möglich, die Meridiane, mit denen sie operiert, sichtbar zu machen – sie sind eine Theorie, die aber plausibel wird, je mehr positive Forschungsdaten für die Methode vorliegen.
In der Schweiz fehlt es an spezifischen Forschungsgeldern für komplementär- und integrativmedizinische Methoden.» Dr. med. Pierre-Yves Rodondi
Zweitens zeigt das Beispiel Akupunktur, dass mehr Evidenz nur mit mehr Forschung zu haben ist. Und da findet der Professor deutliche Worte: «In der Schweiz fehlt es an spezifischen Forschungsgeldern für komplementär- und integrativmedizinische Methoden. Wenn wir auf sie aber die gleichen Standards anwenden wollen wie auf die Schulmedizin, muss sich das unbedingt ändern. Es braucht dazu nur den politischen Willen.»
Für einen modernen Evidenzbegriff
 Der Dachverband Komplementärmedizin setzt sich für gute Rahmenbedingungen für die Komplementärmedizin ein, auch in der Forschung. Und er fördert politisch und in der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit einen modernen Evidenzbegriff auf dem Stand der neusten Forschung, beispielsweise mit diesem Beitrag, vor allem aber im Bundesparlament.
Der Dachverband Komplementärmedizin setzt sich für gute Rahmenbedingungen für die Komplementärmedizin ein, auch in der Forschung. Und er fördert politisch und in der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit einen modernen Evidenzbegriff auf dem Stand der neusten Forschung, beispielsweise mit diesem Beitrag, vor allem aber im Bundesparlament.
In politischen Vorstössen, die die Komplementärmedizin schwächen wollen, sprechen Politiker der Komplementärmedizin immer wieder die Wirksamkeit ab, indem sie Evidenz mit klinischen Studien gleichsetzen – sei es aus Unwissen, oder aber, weil sie den Begriff für ihre politischen Zwecke instrumentalisieren. Der Dakomed, seine 14 Mitgliederverbände und die integrative Forschungsgemeinschaft treten diesen Vorstössen vehement entgegen.
Mehr Forschung – jetzt
Der Dachverband Komplementärmedizin setzt sich im Bundesparlament dafür ein, dass endlich mehr Forschungsmittel für Komplementärmedizin gesprochen werden. Denn die integrative Medizin, die Zusammenarbeit von Schul- und Komplementärmedizin, ist ein Erfolgsmodell bezüglich Wirksamkeit und Kosten, das zu fördern ist. In der Sommersession wird der Dakomed einen nächsten parlamentarischen Vorstoss einreichen lassen.
Ebenfalls lässt er parlamentarische Vorstösse in jenen Kantonen einreichen, in denen ein Studium der Humanmedizin möglich ist. Es soll sichergestellt werden, dass Forschungsmittel spezifisch für Komplementärmedizin gesprochen werden. Die Forschungsförderung ist ein Verfassungsauftrag, den Bund und Kantone umzusetzen haben – der Dakomed fordert die Erfüllung des Auftrags mit gezielter Informationstätigkeit in den jeweiligen Parlamenten.
Wie und wo in der Komplementärmedizin geforscht wird und warum dies für eine evidenzbasierte Medizin wichtig ist, lesen Sie in diesen Millefolia-Artikeln:
- Forschung mit Herz, Hand und Verstand
- Homöopathie wirkt – das zeigt die Forschung
- Die Wünsche der Patientinnen und die Erfahrung der Ärzte zählen auch
Quellen:
- Acupuncture for Chronic Pain: Update of an Individual Patient Data Meta-Analysis – National Library of Medicine
- Akupunktur zur Vorbeugung von Migräneanfällen – Cochrane Kompakt
Bilder: Redaktion Millefolia – Freepik.com-AI / Miriam Kollmann – mk-photography.ch / Wavebreak Media – Freepik.com / Freepik – Freepik.com
Braucht die Komplementärmedizin mehr Forschung?
Nachdem Sie unseren Artikel gelesen haben: wie stehen Sie zur Aussage, dass die integrative Medizin noch gewissenhafter erforscht werden sollte? Gerne können Sie Ihre Erfahrungen mit den anderen Millefolia-Leserinnen teilen!
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Jede noch so kleine Spende hilft, künftige Beiträge zu ermöglichen. Herzlichen Dank!
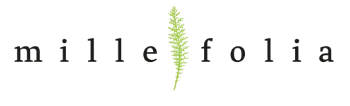

1 Kommentar
Danke für ihr Engagement!